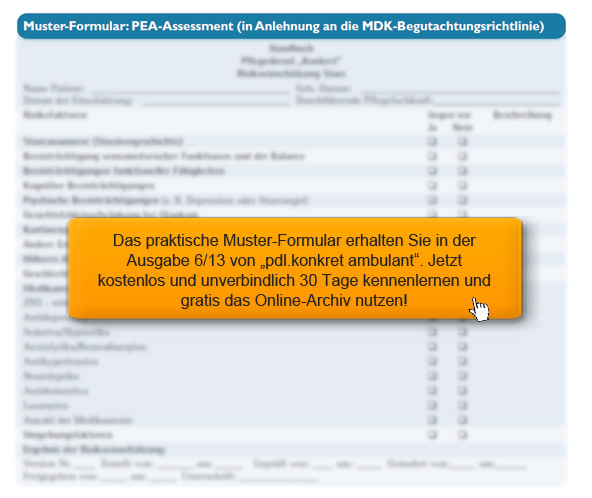Sturzprophylaxe in der Pflege: Welche Änderungen Sie in Ihren pflegerischen Alltag einfließen lassen müssen
(aus pdl.konkret ambulant)Der Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“ erschien im Februar 2006. Nun ist die
1. Aktualisierung veröffentlicht worden.
Aufgrund neuerer Erkenntnisse wurden
einige Anpassungen notwendig. Wir haben
diese Überarbeitung zum Anlass
genommen, Ihnen in dieser und der
nächsten Ausgabe aufzuzeigen, welche
Änderungen Sie beachten müssen und
wie Sie diese in Ihren pflegerischen Alltag
einfließen lassen können.
Änderungen in der Definition
Die bisherige Definition wurde geändert, da sogenannte „Beinahe-Stürze“ nicht eingeschlossen waren. Die neue Definition lautet daher nun: „Ein Sturz ist jedes Ereignis, bei dem der Betroffene unbeabsichtigt auf dem Boden oder auf einer anderen tieferen Ebene aufkommt.“ Hiermit soll berücksichtigt werden, dass Ihre Patienten nach einem Sturz auch im Sitzen oder Hocken aufkommen können, z. B. weil Ihr Patient von einem Ihrer Mitarbeiter aufgefangen wird. Die neue Formulierung hat aber nicht zur Folge, dass Sie nun auch alle „Beinahe-Stürze“ dokumentieren müssen.
Neu: Systematische Risikoeinschätzung
In der Kriterienebene 1 wurden die meisten Änderungen vorgenommen. Diese Ebene beschäftigt sich mit der systematischen Einschätzung des Sturzrisikos. Neu ist nun, dass nicht mehr von Wissen zu und Erfassung von Sturzrisikofaktoren, sondern nur noch vom Sturzrisiko gesprochen wird. Hierdurch soll deutlich werden, dass die Bewertung des tatsächlich individuellen Sturzrisikos Ihres Patienten höchste Priorität hat.
Dies dürfte Ihnen auch schon von der Aktualisierung des Expertenstandards zur Dekubitusprophylaxe bekannt sein. Aufgrund dieser Änderung gibt es nun auch keine Auflistung der extrinsischen und intrinsischen Sturzrisikofaktoren mehr. Dafür müssen Sie sich nun verstärkt an Ihrer pflegefachlichen Einschätzung orientieren. Die gibt Ihnen einen Überblick über die nun, unabhängig von der Ausrichtung der Pflegeeinrichtung (also egal, ob ambulant, teilstationär oder stationär), bedeutsamen personen-, medikamenten- und umgebungsbezogenen Risikofaktoren.
Beachten Sie, dass nun neu als Risikofaktoren auch freiheitsentziehende Maßnahmen hinzugekommen sind.
Hinweis: Mit dem nachfolgenden Formular können Sie aufgrund Ihres pflegefachlichen Sachverstandes eine Risikoeinschätzung bei Ihren ambulant betreuten Patienten vornehmen.
| Übersicht: Klinische Einschätzung der Pflegefachkraft |
| Personenbezogene Risikofaktoren |
|
| Medikamentenbezogene Sturzrisikofaktoren |
|
| Umgebungsbezogene Sturzrisikofaktoren |
|
* in der Literaturstudie nicht belegte Risikofaktoren, die der Expertenarbeitsgruppe Sturzprophylaxe 2012 – 2013 dennoch relevant erscheinen Aus: Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP): Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege, 1. Aktualisierung 2013, Seite 25

Neuer Stellenwert der Beratung und Schulung
Neu aufgenommen wurde das Angebot von Schulungen, denn es hat sich gezeigt, dass eine verständliche Information das Problembewusstsein bei Ihren Patienten und auch bei seinen Angehörigen erhöhen kann. Um Ihren Patienten und deren Angehörigen eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der durchzuführenden Schritte zu geben, sollten Sie vor der Festlegung von Interventionen eine ausführliche Schulung, Information und Beratung zu den präventiven Maßnahmen durchführen.
Geben Sie Ihrem Patienten und seinen Angehörigen in diesem Zusammenhang auch individuelle Empfehlungen für eine sichere Umgebung. Legen Sie bei Ihrer Schulung großen Wert darauf, dass Sie Ihre Informationen über das Für und Wider der empfohlenen Maßnahmen verständlich vermitteln.
Ziel Ihrer Beratung sollte es sein, dass Sie Ihren Patienten und seine Angehörigen in der Entscheidungsfindung unterstützen und helfen, sich für Maßnahmen zu entscheiden, die das Sturzrisiko senken, ohne dass lebenswichtige und lebenswerte Bereiche der persönlichen Freiheit und Lebensgestaltung eingeschränkt werden. Sollte Ihr Patient Ihre Vorschläge und Empfehlungen ablehnen, respektieren Sie diese Entscheidung. Das, was Ihr Patient wünscht, hat bei allem Ihrem Handeln höchste Priorität.
Sämtliche gegebenen Informationen, Empfehlungen und Beratungen sowie die Reaktion Ihres Patienten müssen Sie in der Patientenpflegedokumentation dokumentieren. Zum Abschluss Ihrer Beratung sollten Sie, wie gehabt, Ihrem Patienten und seinen Angehörigen ein Informationsschreiben überreichen. Vergessen Sie nicht sich den Erhalt quittieren zu lassen.
Hinweis: Ein Musterinformationsschreiben finden Sie in der Ausgabe 06/2010 von „pdl.konkret ambulant“. Dieses Schreiben ist noch aktuell.
Nutzen Sie als PDL.konkret ambulant Kunde das online Archiv